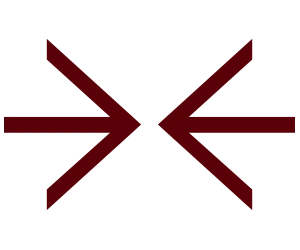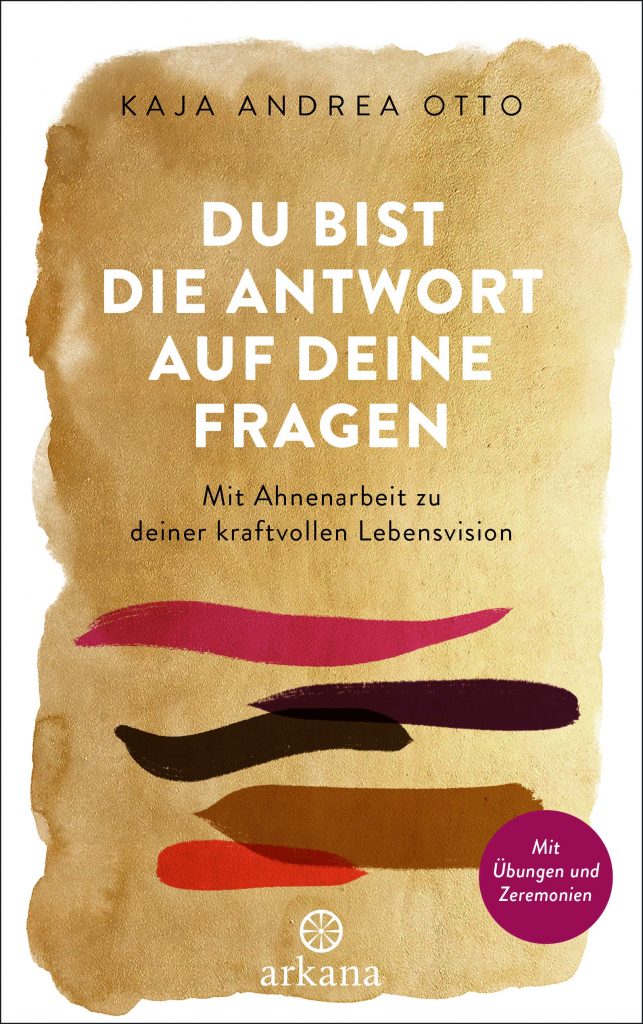SAMHAIN EINMAL ETWAS ANDERS
Wenn das Licht sinkt und die Schatten länger werden, wenn die Luft abends kühler schmeckt und so langsam der Nebel zwischen den Bäumen hängen bleibt, dann ist sie wieder da: die Zeit von Samhain. Dabei ist es wichtig zu wissen: Samhain ist kein einzelner Tag oder eine Nacht. Es ist ein Atemholen im Jahreskreis, ein Übergang, ein Innehalten. Eine Brücke zwischen dem, was war, und dem, was werden will.
Was wir heute als Halloween, Allerheiligen oder Allerseelen erinnert nur noch in Bruchstücken an die wahre Bedeutung von Samhain. Denn Samhain war eine Zeitphase, bestimmt von zyklischen Rhythmen. Der elfte Neumond nach der Wintersonnenwende, oder je nach Region auch manchmal der 2. Neumond nach Equinox war der Moment von Samhain.
Dabei war es kein gruseliger Herbstbrauch und es gab auch keine Süßigkeiten. Sondern es gibt viele verschiedene Bräuche, die wir auch heute noch in unseren Alltag integrieren können, um uns zu verbinden: mit dem Rhythmus der Jahreszeiten und der Weisheit der Ahnen.
Seitdem ich im Einklang mit dem Jahreskreis, dem europäischen Medizinrad und damit auch den kosmischen Bewegungen bin, bekomme ich keine Herbstdepression mehr oder Winterblues. Ich wünsche mir keinen ewigen Sommer herbei, sondern freue mich wirklich auf den Winter. Denn: jede Zeit im Jahreskreis hat ihre einzigartige Qualität. Wenn wir innehalten und uns auf die alten Rhythmen der Natur einlassen, dann erkennen wir: Der Winter ist nicht nur eine Zeit des Mangels, sondern eine der größten Quellen für Kraft und Erneuerung.
Im alten europäischen Jahreskreis steht der Abschnitt von Samhain bis Imbolc für Rückzug, Stille und Tiefe. Während der Frühling das Wachstum bringt, der Sommer die Fülle und der Herbst die Ernte, ist der Winter die Zeit des Innehaltens und des Erneuerns – das große Einatmen der Natur. Alles Leben zieht sich zurück: Pflanzen versinken in ihre Wurzeln, Tiere suchen Schutz und Ruhe. Auch wir Menschen tragen diesen Rhythmus in uns, auch wenn unser Alltag oft nicht darauf ausgerichtet ist. (Wenn du tiefer eintauchen willst, klick hier)
Das Einläuten einer Phase
Direkt vorab: Samhain ist NICHT der 31. Oktober. Dieses Datum wurde es später durch die Kirche festgelegt. Samhain ist ein Mondfest und daher fluide im Kalender, der sich ja an dem solaren Jahr orientiert. Im Ursprung war Samhain das Einläuten einer Phase.
Dabei ist der Satz: „Der Schleier zwischen den Welten wird dünner“ einer, der oft für die Zeit verwendet wird. Jedoch stammt dieser vermutlich erst aus romantisierender Esoterik des 19. und 20. Jahrhunderts und nicht aus alter Überlieferung.
Denn wenn wir zurückblicken, dann gibt es keinen plötzlich lichten Schleier, der nur an wenigen Tagen so dünn ist. Der Zugang zu den Ahnen ist nicht von besonderen Konstellationen abhängig – sondern von Bewusstheit, Bereitschaft und Ehrlichkeit.
Es braucht keine Schwelle – die Ahnen sind immer da
Unser westlicher Mythos, wir müssten warten, bis einmal „die Schwelle“ offen ist, wurde uns oft verkauft – damit wir uns machtlos fühlen. Aber du kannst jederzeit mit deinen Ahnen sprechen, unabhängig von Datum und Stunde. Das wirkliche Leben ist zyklisch, nicht punktuell.
Was in dieser Zeit jedoch geschah, war, dass die Menschen das Vieh von den Weisen holten. Damit im Zuge dessen keine „wilden Geister“ mit auf den Hof und in die Ställe kamen, trieb man das Vieh zwischen Feuern durch den Raum. Man räucherte es im wahrsten Sinne des Wortes. So wie es auch heutzutage noch in vielen Traditionen der Fall ist, wenn man das Haus betritt. Es ist quasi die Reinigung, um nichts Unerwünschtes mit ins Haus zu bringen. Dabei ging es zu der Zeit nicht um Ahnen, sondern um Naturgeister.
Denn damals gab es noch das Bild von unserer Welt und der anderen Welt, jenseits der Hecke. Und die Heckensitzerin – die Hag bzw. Hexe war diejenige, die in diesem Raum dazwischen agierte.
Was zu dieser Zeit ebenfalls geschah, ist, dass man die schwachen Tiere und diejenigen, die den Winter nicht überstehen würden schlachtete. Damit war die auch die Zeit des Todes im wahrsten Sinne. Und so kam es auch, dass sich Bräuche und Legenden vermischten und irgendwann die Toten mit dazu kamen, die Ahnen.
Laterne, Laterne, Sonne Mond und Gans?
Viele Menschen denken: Heiliger Martin, Laterne, Gans essen – das gehört zusammen. Aber wer den Ursprung kennt, erkennt einen viel älteren Faden. Die „Martinsgans“ war ursprünglich die Gans der Göttin – ein heiliges Tier, das als Symbol für Übergang, Fruchtbarkeit, Verwandlung diente.
In alten Kulturen wurde dieses Tier geweiht, geopfert, als Geschenk an die Göttin gegeben – ein Akt der Dankbarkeit für das Licht, für die Nahrung, für das, was getragen wurde durch den Sommer. Der Mantel, der geteilt wurde, war nicht nur christliche Legende, sondern spiegelt eine archetypische Geste: Teilen in Zeiten des Abschieds.
Als die Kirche solche Riten überformte, blieb der symbolische Kern oft erhalten – aber der Blick wurde verrutscht. Heute gilt der gute St. Martin als Symbol des Teilens. Früher ging es jedoch um die Energie jenseits von Personifikation – ein Urgefühl von Opfer, Hingabe, Anerkennung.
Wenn wir an St. Martin denken, dann kommen uns auch oftmals direkt die Laternen in den Sinn. Doch auch deren Ursprung hat nichts mit dem Heiligen zu tun. Denn „Laterne Laterne Sonne Mond und Sterne“ hat eine tiefe Bedeutung – Sonne, Mond und Sterne weisen uns den Weg durch die dunkle Jahreszeit. Und es waren damals auch keine Kürbisse, sondern schlichte Rübenlaternen. In Dörfern Mitteleuropas nahm man Zucker- oder Futterrüben, höhlte sie aus und setzte ein Licht hinein.
Als europäische, oftmals irische Siedler nach Amerika kamen und auf Kürbisse stießen, übernahmen sie diese Form – musterhaft, aber das Bewusstsein über den Ursprung ging verloren. Und so wurde die Laterne zu Halloween-Kitsch entzaubert.
Alte Bräuche wiederbeleben ist aktive Heilung
Doch wir können auch heute noch bewusst ein Licht entzünden, vielleicht nicht mehr in einer Rübe aber in einem irdenen Gefäß, welches uns erinnert – wir können uns Licht sichtbar werden lassen, nicht bloß dekorativ, sondern wirkmächtig. Und damit den Ahnen den Weg nach Hause weisen. Denn diese Verbindung haben wir allzu lange verloren gegeben, vor allem in Europa.
Wir tragen eine schmerzhafte Geschichte in uns: Über Jahrhunderte wurde unsere ursprüngliche indigene Spiritualität verdrängt, überformt oder ausgelöscht. Die Mühle der Missionierung mahlte gnadenlos – und wir, wir tragen das Erbe dieser Auslöschung in unserem Nervensystem. Umso wichtiger ist es durch kleine Rituale die Verbindung wieder herzustellen.
Wenn wir heute Samhain wieder begehen, kreieren wir kein nostalgisches Revival. Wir schaffen eine Rückverbindung. Wir erwecken Erinnerung. Wir erleben Heilung – nicht nur individuell, sondern auch kulturell.
In vielen Kulturen weltweit – wie dem Día de los Muertos – wird der Tod nicht verdrängt, sondern gefeiert. Die Toten kommen nicht „in den Himmel“, sondern sie sind präsent. Sie sitzen mit uns. Sie trinken mit uns. Und sie erzählen uns Geschichten.
Wir sind der Schlüssel zur alten Weisheit
Wir, in Europa, haben das Wissen nicht vollständig verloren – nur verschüttet. Und Samhain ist ein Schlüssel, um es wieder zu beleben.
Und so können wir Samhain eben auch zur Verbindung mit den Ahnen nutzen. Denn Wir holen nicht nur das Vieh, sondern auch sie wieder nach Hause. Und so können wir die Kerzen für die Ahnen anzünden, einen Platz am Tisch für sie freihalten und für sie mit eindecken. Das ist kein mystischer Hokuspokus. Es ist bewusste Teilnahme an lebendiger Tradition.
Samhain führt uns zurück – zurück zu dem, woraus wir stammen, zurück zu dem, was wir sind. In diesem Rückzug liegt Aufbruchskraft. In dieser Dunkelheit lodert ein neues Licht.
Wenn du Lust hast gemeinsam durch die dunkle Jahreszeit zu gehen, verbunden mit der alten Weisheit, dann klick hier.
Und falls du ein Podcastfan bist – dann ist die Samhain-Folge das Richtige für dich.
In Sisterhood.